Zurzeit wird ja sehr viel über Identitätspolitik diskutiert, und da mich das Thema nun schon etwas länger beschäftigt, möchte ich nun auch ein paar Gedanken dazu niederschreiben.
Zunächst mal eine Anmerkung vornweg: Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich als heterosexueller weißer Mann aus christlichem Elternhaus zu den Privilegierten dieser Welt gehöre. Oder um es mal mit Spiegel Online-Kolumnistin Margarete Stokowski zu sagen: Ich weiß, dass ich nicht diskriminiert werden kann. Ich sehe es zudem auch so, dass es den Diskriminierten überlassen werden sollte, zu beurteilen, ob etwas diskriminierend ist oder nicht. Und wer meine Artikel in diesem Blog verfolgt, der weiß auch, dass ich mit der Geisteshaltung des „alten weißen Mannes“ ziemliche Probleme habe (s. hier, hier und hier).
Dennoch nehme ich mir die Freiheit, etwas zu kommentieren, wenn es mich interessiert, zumal wenn ich der Ansicht bin, dass da gerade etwas reichlich verkehrt läuft.
Schließlich ist die Identitätspolitik zurzeit ein ziemlicher Zankapfel, wie man nicht nur an der SPD sehen kann, nachdem Wolfgang Thierse sich kritisch dazu geäußert hat und dafür dann gleich mal zurechtgewiesen wurde von seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken – was dann sogar so weit eskalierte, dass Thierse seinen Austritt aus der SPD angeboten hatte (s. hier).
Dabei ist dieser Diskurs nun nicht ganz neu, beispielsweise wurden entsprechende Aussagen von Sahra Wagenknecht (Linke) und Sigmar Gabriel (SPD), die sich kritisch zum Überhandnehmen von identitätspolitischen Inhalten aufseiten der Linksdenkenden äußerten, bereits im Oktober letzten Jahres in einem Artikel im Tagesspiegel thematisiert.
Und auch bei der Niederlage von Hillary Clinton vor gut vier Jahren gegen Donald Trump der der US-Präsidentschaftswahl gab es kritische Stimmen, die meinten, Clinton hätte sich zu sehr auf Identitätspolitisches fokussiert, sodass Trump viele Wähler für sich gewinnen konnte, die mit sehr realen existenziellen Sorgen konfrontiert sind (s. beispielsweise hier).
Diese Kritik kann ich durchaus nachvollziehen. Wer nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll, ob der Arbeitsplatz noch sicher ist, wie er mit seiner kümmerlichen Rente über die Runden kommen soll oder was man den Kindern zum Monatsende noch auf den Tisch stellen soll, der hat in der Regel herzlich wenig Interesse an gendergerechter Sprache – so mal frei nach der Maslowschen Bedürfnispyramide.
Was nun nicht heißen soll, dass Geschlechtergerechtigkeit keine wichtige Sache wäre. Nur fängt die eben bei vielen Frauen, die nach wie vor häufiger von Armut betroffen sind als Männer, eher beim Blick in den Kühlschrank oder aufs Kontominus an als bei Gender-Sternchen. Insofern wird hier m. E. das Pferd ziemlich von hinten aufgezäumt.
Aber das ist ja auch sehr bequem: Wer sich aus gut situierter Position heraus Gedanken über sprachliche Feinheiten machen kann, der muss nicht an die wirklichen Probleme ran, die a) ihn selbst nicht betreffen und b) deren Lösung vielleicht sogar eine Änderung an dem System, von dem man doch selbst profitiert, erfordern würde.
Sprache ist eine lebendige Angelegenheit, die sich in einem ständigen Wandel befindet. Dass beispielsweise diskriminierende Begriffe wie „Neger“ oder „Zigeuner“ weitgehend aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind (außer natürlich bei Rechtsaußen-Polterern), finde ich ausgesprochen begrüßenswert. Und es macht ja nun auch in der Tat keinen Unterschied, ob ich Lebensmittel als „Schaumkuss“ oder „Balkansoße“ bezeichne. Wenn hingegen in die sprachliche Struktur eingegriffen wird, sodass bei jedem Satz überlegt werden muss, ob das nun so korrekt gegendert ist oder nicht, dann ist das schon mal eine andere Nummer.
Ich will damit nicht ausschließen, dass sich auch so etwas sprachlich entwickeln könnte und irgendwann zur Normalität würde, allerdings kommt es eben vielen Menschen zurzeit so vor, als ob ihnen das quasi „von oben“ ausgepfropft wird – und das sorgt dann eben weniger für Zustimmung, sondern mehr für Widerstand.
Das ist den Befürwortern einer gendergerechten Sprache auch durchaus bewusst, wie man an einem Artikel auf News.de über den Auftritt der heute-Moderatorin Petra Gerster in der ARD-Talkshow maischberger sieht. Dort ging es nämlich genau darum, dass in den heute-Sendungen nun das Gender-Sternchen mitgesprochen wird, was auf Ablehnung bei vielen Zuschauern stößt – laut Gerster sogar bei „den meisten“.
Nun muss die Mehrheit nicht immer recht haben, aber zumindest spiegelt sie den aktuellen Status quo wider, und dieser scheint nun so zu sein, dass das Mitsprechen von Gender-Sternchen in Nachrichtensendungen auf keine breite Akzeptanz stößt. Und in dem Moment ist es eben keine sprachliche Entwicklung, die aufgegriffen und von mir aus auch verstärkt wird, sondern eine Art des Oktroyierens. Und das hat dann meiner Erfahrung nach vor allem folgende Auswirkung: Diejenigen, die dem eh schon zustimmen, brauchen ihre Ansicht nicht zu ändern, und diejenigen, die das ablehnen, werden auf diese Weise eher abgestoßen, sodass sich ihre Ablehnung weiter vertieft.
Zudem habe ich den Eindruck, dass derartige identitätspolitische Maßnahmen oft als eine Art Feigenblatt fungieren. Ein schönes Beispiel, wie nämlich die Verwendung gendergerechter Sprache nicht zu einer Änderung im patriarchalischen Denken führt, hat kürzlich die Berliner Zeitung in einem Posting, das ich auf der Facebook-Wall von Fabio de Masi (Linke) entdeckt habe, geschildert:
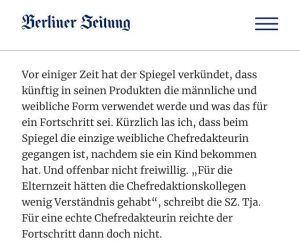
Solange patriarchalisches Denken und die dazugehörigen Strukturen unseren Alltag prägen (man schaue sich nur mal das Marketing für Mädchen und Jungen an – nach wie vor meistens schön Rosa und Blau -, was dazu führt, bestimmte Muster schon von klein auf bei den Kindern zu verinnerlichen), solange Formate wie „Germany’s Next Top Model“ zur Fernsehnormalität gehören, solange es einen Gender-Pay-Gap gibt, wirkt es auf mich wie ein bisschen wohlfeile Kosmetik, Gender-Sternchen zu verwenden.
Und das gilt auch für andere Bereiche: Natürlich ist es richtig, nicht mehr ein Wort wie „Neger“ zu gebrauchen, aber solange man Afrikaner vonseiten der Politik immer noch als Menschen zweiter Klasse sieht, in deren Länder neokoloniale Strukturen aufrechterhalten werden (Burgis-Interview) und die man zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken lässt, wirkt das dann doch ein kleines bisschen unaufrichtig, oder?
Nebenbei bemerkt: Dass nun in den letzten Jahrzehnten immer öfter Frauen in Regierungsverantwortung oder wichtigen politischen Ämtern waren, hat dann auch nicht wirklich etwas an diesem bei uns nach wie vor herrschenden patriarchalen System verändert. Genauso wenig wie US-Präsident Barrack Obama nun die Lebenswirklichkeit der allermeisten Afroamerikaner verbessert hätte. Black Lives Matter wurde beispielsweise schon 2013 ins Leben gerufen, also während Obamas Präsidentschaft.
Wer von dieser identitätspolitischen Fixierung profitiert, sind vor allem Rechte, wie man ja an Trump gesehen hat, die sich dann deutlich und oft anstandslos dagegen aussprechen und somit Zustimmung ernten bei denjenigen, deren Leben von anderen Nöten geprägt ist. Und diese Rechtsaußen bekommen ja auch immer wieder Steilvorlagen von identitätspolitischen Eiferern, die dann genüsslich von den einschlägigen Medien ausgeschlachtet werden. So berichtet aktuell beispielsweise gerade ein Focus-Artikel, dass Wissenschaftler in Australien angeblich die Begriffe für Mutter und Vater abschaffen wollen. Dass das dann mal wieder nicht so dramatisch ist, wie es die Überschrift assoziiert, ist natürlich typisch, aber die Aufregung der Gender-Gegner ist bei so einem Artikel natürlich gewiss.
Auch wenn Identitätspolitik meist als eher linkes Anliegen wahrgenommen wird, so ist deren ursprüngliche Erfindung Ende des 18. Jahrhunderts doch auf konservative Kräfte zurückzuführen (s. hier). Und klar: Nationalismus ist ja letztlich auch eine identitätspolitische Angelegenheit.
Hier wäre es m. E. nun sinnvoll, eine gemeinsame Position zu entwicklen, für die sogar eine breite Basis bestünde: Viele Menschen mit existenziellen Nöten sind Frauen oder haben einen Migrationshintergrund. Das ergäbe schon mal eine ziemlich große Schnittmenge. Nun müsste nur noch zusammengeführt werden, dass die Armut dieser Menschen eben zu einem großen Teil auf strukturelle Ungleichheit zurückzuführen ist – und diese gilt es dann ganz konkret anzugehen. Wenn hier dann irgendwann vorangeschritten wird, dann mag auch die Sprache dem einmal folgen.
Ansonsten bleibt Identitätspolitik ein Mittel für diejenigen, die das Teile-und-herrsche-Prinzip praktizieren. Was dann auch erklärt, warum sich so viele Neoliberale dafür begeistern.
Wenn diese nämlich identitätspolitische Themen besetzen, dann wollen sie m. E. nicht wirklich etwas für benachteiligte Menschen verbessern, sondern vielmehr bestehende ungerechte Zustände weiter zementieren. Gender-Sternchen tun Vermögenden und Konzernen nicht weh, denn sie schmälern nicht deren Profite, gerechte Bezahlung für Frauen hingegen schon, genauso wie Lieferketten, in denen Zuarbeiter in anderen Ländern nicht als Menschen zweiter Klasse bezahlt und ausgebeutet werden.
Dass passt dann auch wunderbar zur Symbolpolitik, die von Neoliberalen und Konservativen gern praktiziert wird und die auch nicht wirklich etwas ändern will. So wie beispielsweise „Wir schaffen das!“ sagen im Zuge von immer mehr eintreffenden Geflüchteten, gleichzeitig aber die finanziell eh schon oftmals ausgebluteten Kommunen mit den praktischen Aufgaben hängen lassen, das Asylrecht immer restriktiver verschärfen, Tausende im Mittelmeer ertrinken lassen und Fluchtgründe im globalen Süden nicht bekämpfen, sonder weiter verursachen. Und wie man sieht, funktioniert das ja auch, da es immer noch genug Leute gibt, die Angela Merkel wegen dieser einen Aussage eine flüchtlingsfreundliche Politik attestieren.
Bleibt abschließend noch die Frage, ob es nun Zufall ist, dass das gerade jetzt so hochkocht, wo immer mehr Kritik am Corona-„Krisenmanagenment“ der Bundesregierung laut wird und die CDU eine Korruptionsaffäre nach der anderen hinlegt. In jedem Fall hat das Thema gerade schon auch ein bisschen Nebelkerzenfunktion, um von diesen Missständen abzulenken. Der Wirecard-Skandal, bei dem immer mehr Ungeheuerlichkeiten ans Licht kommen, wird zumindest nicht ansatzweise so prominent in der Öffentlichkeit diskutiert …
So bleibt für mich als Fazit, dass Identitätspolitik, die spaltet statt zu vereinen, die sich vor allem auf Symbolisches konzentriert und nicht auf tatsächlich vorhandene Missstände, vor allem denen in die Hände spielt, die nichts ändern wollen am aktuellen System, das zunehmend mehr Ungerechtigkeiten produziert. Es gilt also, feministische, antirassistische, soziale, LGBT- und auch ökologische Bewegungen zusammenzubringen, indem aufgezeigt wird, dass die Ursache für ihre Diskriminierung und Missachtung ein und dieselbe ist, nämlich das neoliberal kapitalistische Wirtschaftssystem.



Ein schön eingeleiteter und ausgeschriebener Beitrag, danke!
Na klar bestimmt Sprache das Denken, wie das mit dem Framing eben so ist, aber hier trifft die Kritik eben voll zu: Reden und Handeln sind zwei sehr unterschiedliche Sachen und in der Politik ist diese Diskrepanz ausgeprägter, als in so ziemlich jedem anderen Bereich.
Es ist eben genau so: Sprachliches gendern kostet eben die Geldgeber der Lobbyisten nichts, aber wirklich handeln und an den Gegebenheiten grundlegendes ändern wollen die wenigsten.
In ihrer schön geschriebenen Kolumne auf Spiegel Online betont Sibylle Berg ebenfalls das Spalterische, das formalisierter Identitätspolitik innewohnt. Sehr lesenswert!
Sebastian Puschner geht in einem Artikel für der Freitag der Frage nach, warum identitätspolitische Themen so viel präsenter sind als verteilungspolitische. Und er kommt zu einem recht einfachen, aber auch ernüchternden Schluss: In den Parlamenten sitzen in der Regel nur noch Besserverdiener mit höherem Bildungsabschluss, die sich für Armut gar nicht so recht interessieren, weil es sie eben nicht betrifft. Und diejenigen, die existenzielle Sorgen haben, werden nicht nur zunehmend mehr von den Wahlurnen, geschweige denn von Abgeordnetenmandaten ferngehalten, weil sie immer stärker den Eindruck bekommen, dass sich für ihre Situation eigentlich niemand in der Politik so recht interessiert.
Da das Gendern von Sprache ja auch im obigen Artikel thematisiert wurde: Lara Schwenner bietet in einem Artikel für Quarks einen sehr differenzierten Blick auf geschlechtergerechte Sprache. Sehr lesenswert!